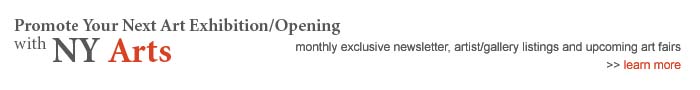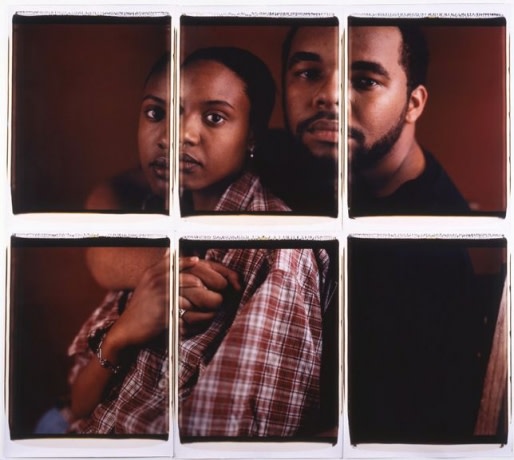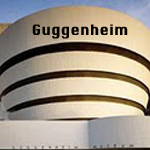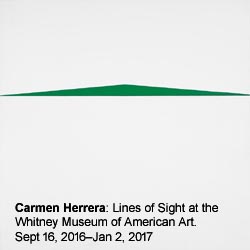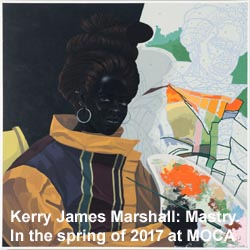Medium: Installation–Der Berliner Kunstverein empty rooms
Matthias Harder
Das Medium Installation hat zu einer Neudefinition des Ausstellungsraumes geführt; dieser ist nicht mehr bloße Hülle für das ausgestellte Kunstwerk, sondern verbindet sich mit ihm zu einem Ganzen. Es gibt viele Vorläufer in der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts; doch insbesondere die Erlebnisräume und teilweise benutzbaren Environments der sechziger Jahre von Edward Kienholz, Joseph Beuys, Marcel Duchamp, George Segal oder Bruce Nauman, sowie manche land art-Werke haben Installationen der achtziger und neunziger Jahre, beispielsweise von Tony Oursler, Gordon Matta Clark, Damien Hirst, Ilya Kabakov, James Turrell, Chris Burden oder Jason Rhoades, erst möglich gemacht.
Das Medium Installation ist zu einem der wichtigsten Bestandteile der zeitgenössischen Ausstellungspraxis geworden, doch nur wenige Institutionen kümmern sich ausschließlich um diese Kunstform. Zwei Ausstellungsorte besitzen hier eine Vorbildfunktion: die Mattress Factory in Pittsburgh, Pennsylvania und das Museum of Installation in London. Die amerikanische Institution, inzwischen in zwei großen Gebäuden untergebracht, sammelt Installationen internationaler Künstler für Langzeitausstellungen. Die raumgreifenden Arbeiten werden hier zu „Interieurs", in denen sich der Betrachter frei bewegen kann. Das Londoner Museum of Installation dagegen archiviert seit Jahren Spuren und Dokumente der dort realisierten Installationen. Vergleichbare Institutionen, die systematisch Installationen sammeln oder archivieren, fehlen im deutschsprachigen Raum.
Das von Thrafia Daniylopoulos und mir erdachte Projekt „in our empty rooms", benannt nach einer Textpassage aus T. S. Eliots The Waste Land, das sich 1998 als Kunstverein "empty rooms" institutionalisierte, folgt diesen Vorbildern. Mit dieser Ausstellungsinitiative in einem ehemaligen Ursulinenkloster in Berlin-Kreuzberg präsentierten und vermittelten wir aktuelle Kunst experimentellen Charakters auf unkonventionelle Art. Als Experimentierbühne für Installationen bietet "empty rooms" internationalen Künstlern die Möglichkeit, ein orts- und kontextbezogenes Werk zu realisieren. Mit der Installation Walks der Initiatoren des Londoner Museums of Installation (MOI), Nicola Oxley, Nicolas de Oliveira und Jeremy Woods, begann 1996 die Geschichte dieses deutschlandweit einzigartigen Ausstellungsprojektes. In einer späteren Zusammenarbeit zwischen MOI und "empty rooms" wurden neun Berliner Künstler und Kunsthistoriker eingeladen, ihre Idee eines imaginären Museums in einer etwa DinA4 großen Pappbox zu illustrieren. Die interdisziplinären Ergebnisse des vom MOI konzipierten Malraux Musee Imaginaire Box Project wurden nach Berlin auch an anderen Orten, u.a. in der Tate Liverpool, präsentiert und inzwischen im Londoner Museum archiviert.
Der Präsentationsraum von "empty rooms" wird–entgegen traditioneller Ausstellungspraxis von Galerien und Museen–stets zum Bestandteil des Werkes selbst. Einige Künstler haben gewissermaßen ihr Atelier dorthin ausgelagert. So wurden Objekte nicht nur im Raum arrangiert, sondern vor Ort und in Auseinandersetzung mit dem Ort erarbeitet. Der Betrachter wird schließlich wie der umgebende Raum zum Teil der Installation. Während in anderen Ausstellungsräumen die realisierten Installationen nur von außen wie auf einer Bühne zu betrachten sind, hat "empty rooms" die Besucher meist eingeladen, die Werke zu betreten und haptisch zu erfahren. Manchmal konnte die Entstehung und Demontage der Installationen–nach Absprache mit dem Künstler–miterlebt werden. In dem Zeitraum von 1996 bis 2003 haben fast vierzig Ausstellungen, Vorträge, Präsentationen, Aktionen und Performances in "empty rooms" stattgefunden.
Die albanischen Künstler Besnik und Flutura Haxhillari, seit 1995 als Künstlerpaar international agierend, spielten 1999–noch in den ursprünglichen Präsentationsräumen von "empty rooms"–mit dem Namen des Ausstellungsprojektes; so nannten sie ihre Installation Espace Fragile. Mit genähten Stoffobjekten, die im Ausstellungsraum von der Decke hingen und gewissermaßen Räume im Raum schufen, knüpften sie narrative, teilweise surrealistische Verbindungen. Kleinere Gegenstände steckten in größeren Formen und markierten ein Spiel um Innen- und Außenraum auf verschiedenen Realitätsebenen: in einer großen Stoffhand befand sich ein Küchenmesser, in einem Fuß ein kleiner Schuh oder in einem Schiff eine halbvolle Flasche mit Wasser. Der helle, mit Stoff verkleidete Raum wurde zu einer Bühne, auf der während der Vernissage eine Hochzeits-Performance der weißgeschminkten Künstler stattfand.
Im Frühjahr 2000 wurde "empty rooms" von Karin Pott, der Leiterin vom Haus am Lützowplatz eingeladen, eineinhalb Jahre lang Ausstellungen in der Studiogalerie zu veranstalten. Wir luden Künstler aus Berlin, Hamburg und London ein, die für "empty rooms" relevante Idee einer orts- und kontextspezifischen Arbeit dort zu realisieren. So setzten wir auch die Zusammenarbeit mit dem Museum of Installation fort; deren Direktoren Nicola Oxley und Nicolas de Oliveira arrangierten mit Vanishing Point einen Medienraum mit mehreren Videoarbeiten: visuelle Stellvertreter eines nicht-linearen Erzählstranges, dessen Gegenstand teilweise der Betrachter selbst ist. Ihr Video Dragged zeigt beispielsweise Bilder laufender Filmkameras, die mit hoher Geschwindigkeit über Londons Straßen gezogen und dabei zerstört wurden. Doch das Video zeigt nicht nur die digital bearbeiteten und in „falscher" Reihenfolge aneinandergefügten Aufnahmen, sondern schließlich den Tod der Kamera selbst.
Brigitte Waldachs Installation Sichtung rot–frames markiert die jüngste Zusammenarbeit von empty rooms und einer anderen Berliner Institution, dem Theater am Halleschen Ufer. Auf den Fensterflächen des riesigen Theatergebäudes wird bis Frühjahr 2003 von Waldach ebenfalls eine nicht-lineare Geschichte erzählt: Eine weibliche Erzählerfigur, hier erstmals in ihrem Werk als alter ego inszeniert, führt in die Rahmengeschichte ein. Hinter dem Spiegel oder dem Rahmen beginnt die Geschichte: traumhafte und surreale Räume, springende, schwebende und eingewickelte Menschen, die wie auf einer Bühne agieren. Körperperformance, Traumlogik, Alltagswahn. Das Glas mit den aufgeklebten Figuren generiert einen doppelt illusionären Bildraum.
Es entsteht eine enge formale und inhaltliche Verbindung, innerhalb des Werkes taucht der Rahmen leitmotivisch auf und spiegelt zugleich die strenge Architektur der Theaterfassade. So bieten die Fenster im doppelten Sinne einen Einblick in den realen und narrativen Raum. Die Figuren sind häufig angeschnitten, werden gewissermaßen von der Fassade verdeckt und in den Fenstern, der Membran zwischen innen und außen, sichtbar. Während der gesamten Ausstellungsdauer verwandeln sich nachts die Fensterbänder zu riesigen Leuchtkästen, die über dem Ufer zu schweben scheinen, und das Theater wird zu einem bühnenbildhaften comic-screen.
Die nächsten Installationen von "empty rooms" sind in Zusammenarbeit mit dem gerade entstehenden Ausstellungsprojekt Zeughof 21, ebenfalls in Berlin-Kreuzberg gelegen, geplant.